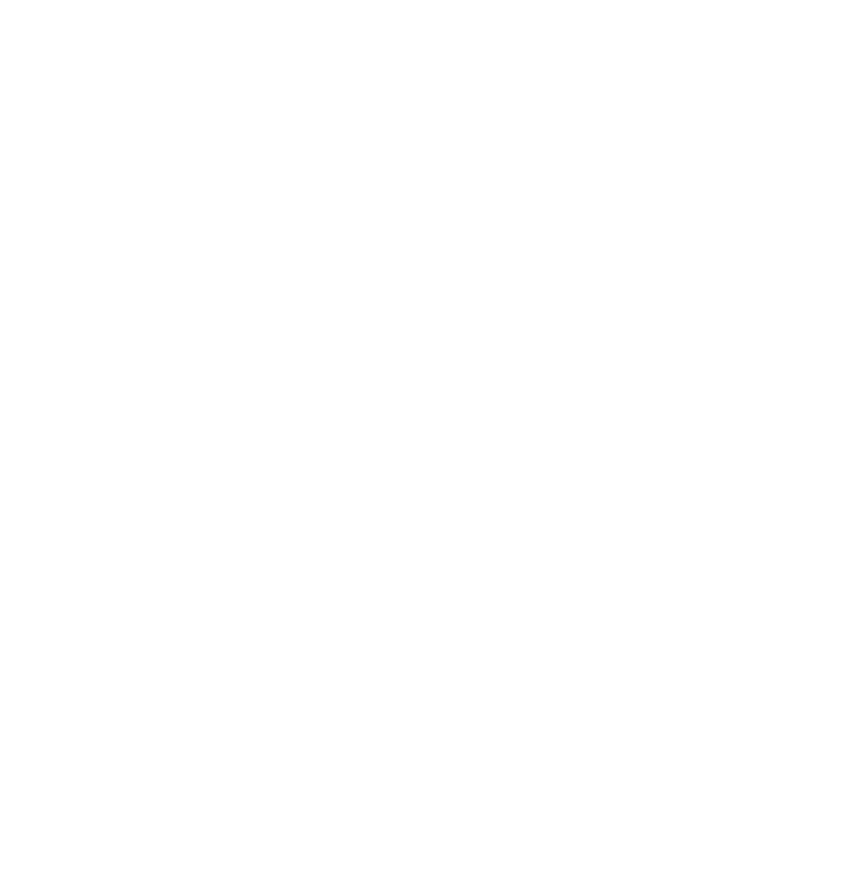Content-Upcycling – Inhalte wie die Produktentwicklung denken
Die iterative Optimierung bestehender Inhalte stellt eine gewinnbringende und ökonomische Strategie zur Umsetzung von Kommunikationszielen dar. Die “6 Re”, wie Robert Weller in seinem Artikel beschreibt, bilden dabei ein wichtiges Werkzeug, um den Kreislauf aus Analyse, Hypothesenbildung, Prototypisierung und Evaluation in die Praxis zu überführen.
Eine thematisch verwandte Methodologie sowohl der Pflege, aber auch der sukzessiven Erweiterung des Content-Portfolio stellt das “Upcycling” dar. Oftmals synonym mit “Recycling” verwendet, gibt es doch wesentliche Unterschiede: Während Recycling die bestehenden Inhalte und verfügbaren Werkzeuge als Ausgangspunkt einer Adaption wählt, rückt Upcycling stattdessen die RezipientInnen sowie deren Bedürfnisse in den Vordergrund. Es ist also – analog zum “product mindset” – inhärent nutzerInnenzentriert.

Gemein sind beiden Herangehensweisen die Mittel: Bestehende Inhalte dienen als Ausgangsbasis für neue Kombinationen, Aktualisierungen und Optimierungen, gestalterische oder thematische Aufwertungen, oder auch die Überführung in neue Kanäle oder Mediengattungen. Die verschiedenen Werteperspektiven formen allerdings das entstehende Produkt in divergierende Ausprägungen.
Ein Wechsel des Blickwinkels
Stellen wir uns etwa eine Baumarktkette vor, die ein Blog zu Heimwerkthemen betreibt. Eine typische Anwendung des Recyclinggedankens mag nun etwa sein, herausragende Artikel mit exzellenten Metrikresultaten zu einem Kompendium im PDF-Format zusammenzufassen – analog eines Whitepapers. Dabei werden Inhalte mit neuen Produktinformationen aktualisiert und angepasst. Das Dokument wird mit MS Word erstellt, das bereits vorhanden ist und mit dem das Content-Team bereits genügend Erfahrung für eine effiziente Umsetzung hat. Hinter einer Registrierschranke zum Herunterladen angeboten, werden über die Verbreitung des PDF auch wertvolle Newsletter-Anmeldungen gesammelt.
Grundsätzlich ist die Vorgangsweise wohlüberlegt. Bemerkenswert ist aber die nach innen gerichtete Perspektive der Entscheidungsfindung: Das Kompendium nützt uns, um Newsletter-Anmeldungen zu generieren. Wir verwenden bestehende Artikel, weil wir damit nichts Neues erzeugen müssen. Wir wählen jene Artikel aus, die unsere Content-KPIs besonders gut erfüllt haben und nutzen in der Umsetzung ein Tool, mit dem wir bereits sehr effizient sind. Gedanken über die Bedürfnisse und die Praxis von RezipientInnen sind der eigentlichen Entscheidungsfindung nachgelagert und reflektieren sich bestenfalls in den Details der Umsetzung.
Das Risiko ist gegeben, neue Inhalte zusammenzusetzen, die in der eigentlichen Rezeption qualitativ (und damit zumeist auch quantitativ) weniger gut als ihre Einzelteile angenommen werden. Zumindest bleiben aber Potenziale ungenutzt. Das Vorgehen entspricht der ursprünglichen Bedeutung des Recyclings, wo das resultierende Produkt niemals besser, tendenziell aber weniger wertvoll als das Ausgangsmaterial wird.
Das entstandene Kompendium mag etwa darunter leiden, dass einzelne Artikel daher besonders gute Metriken erzielt haben, weil sie spezifische Fragestellungen beantworten, die sie als Suchergebnisse prädestinieren – Eine Stärke, die im Content-Verbund verloren geht. Ebenso können die zusammengestellten Artikel für verschiedene Untergruppen der Zielgruppe besonders relevant gewesen sein, die sich daher in der Zusammenstellung thematisch nicht mehr wiederfinden. Die Stolpersteine sind zwar mannigfaltig, aber keinesfalls dem Content inhärent – Sie ergeben sich aus der konkreten Nutzungsweise und den Qualitäten der RezipientInnen.
Wird dasselbe Szenario als Upcycling-Projekt angelegt, ist bereits die Perspektive auf die Ausgangssituation eine andere: Die primäre Frage ist, ob, in welcher Form und innerhalb welcher Handlungskontexte ein Artikelkompendium für die RezipientInnen wünschenswert ist. Manche Inhalte können beispielsweise in bestimmten Phasen des Heimwerkprojekts (Planung, Einkauf, Durchführung, usw…) angemessen sein. Manche sind explorativ und laden zur Abwägung und Gegenüberstellung von Optionen ein, andere sind deskriptiv und unterstützen im konkreten Projekt. Je eingehender das Verständnis der Rollen und Anwendungsfälle, die ein Inhalt erfüllt, desto fokussierter kann die Positionierung des Kompendiums erfolgen.
Auch in der Umsetzung und insbesondere bei der Aufwertung und Optimierung kommt der NutzerInnenzentriertheit große Bedeutung zu: Großzügige Schriftgrade und gute Lesbarkeit auch aus der Ferne sind ein wertvolles “Feature” für all jene, die Smartphone, Tablet oder Ausdruck neben Bohrer, Hammer und Säge legen. Kontrastreichere Bilder oder gar Illustrationen kommen jenen entgegen, die monochrome Ausdrucke auf dem Bürodrucker erstellen. Ein visuelles Glossar etwa ist Gold wert für jene, die nicht jede Dübel- und Schraubenart beim Fachbegriff nennen können.
Im Spektrum zwischen „Inside-Out“ und „Outside-In“
Ursprünglich kennen wir das Konzept der NutzerInnenzentriertheit vor allem aus der Softwareentwicklung. Wenn wir die neueste Version einer Software verwenden und entdecken, dass sie Arbeitsschritte vereinfacht oder angenehmer gestaltet, dann erleben wir das Resultat desselben Kreislaufs aus Evaluation und Optimierung, wie er sich im Upcycling manifestiert.
Tatsächlich findet dieser Dualismus der Perspektivenbildung auch in der ökonomischen Theorie Niederschlag, gerade im Bereich des Innovationsmanagement. Unternehmen werden in einem Spektrum zwischen der „Inside-Out“ und der „Outside-In“ Sichtweise klassifiziert.
„Inside-Out“ Unternehmen sind dadurch charakterisiert, ihre bestehenden Stärken zu erkennen und maximal gewinnbringend einzusetzen. Der Fokus liegt auf kontinuierlicher Effizienzsteigerung (Kostensenkung) und laufender Wertschöpfung aus bereits vorhandenen Ressourcen. Die Risiken liegen dementsprechend in der späten Erkenntnis von Marktbewegungen und -veränderungen, der (Weiter-) Entwicklung von Produkten vorbei an Marktbedürfnissen, sowie der nachhaltigen Schwächungen von KundInnenbindung durch die sukzessive Verschlechterung der customer experience im Kontext von innengerichteten Effizienzsteigerungen.

„Outside-In“ Unternehmen hingegen messen Entscheidungsfindungen am Wert aus KundInnensicht. Die Produkte, aber auch das Angebot (z.B. Vertriebsmodalitäten) und die Kommunikation sind auf die relevanten Zielgruppen zugeschnitten. Das Unternehmen reagiert proaktiv auf Schwächen im eigenen Produktportfolio und optimiert das Angebot iterativ auf Basis von KundInnenbedürfnissen und Feedbackschleifen. Die Positionierung passt sich laufend an veränderte Nutzungsweisen und Trends an. Herausforderungen liegen einerseits in den höheren Aufwänden für die Implementierung einer „Outside-In“ Sicht, die gerade bei traditionellen Unternehmen oft mit grundlegendem kulturellen Wandel verbunden ist. Außerdem sind positive Effekte der NutzerInnenzentrierung oftmals erst in langfristigeren Zeitrahmen erkennbar und vor allem messbar, was als Widerspruch zu datengetriebenen (und daher kurzfristig messbaren) Optimierungen missverstanden werden kann.
Die Betrachtung des eigenen Unternehmens durch die Linsen der „Inside-Out“ und „Outside-In“ Philosophie ist oftmals augenöffnend: Haben wir den Chatbot eingeführt, um Kostenersparnisse im Support zu erzielen oder weil wir Potenziale entdeckt haben, wo ein automatisiertes System KundInnenwünsche zufriedenstellender oder rascher abwickeln kann? Recyclen wir Content, weil wir damit weniger neue Inhalte produzieren müssen oder weil wir gerade im bestehenden Portfolio Feedbacks und Messwerte haben, wo wir noch Potenziale für unsere KundInnen ausschöpfen können?
Die Empathie mit der Zielgruppe
Die Entwicklung einer ganzheitlichen Sicht auf die Lebenswelten der Zielgruppe ist also essentiell für den Upcycling-Ansatz. In Unternehmen, die entsprechend der „Outside-In“ Orientierung Erfahrungen mit der Zielgruppe auch intern propagieren, kann dabei etwa auf die direkten Kontakte der Vertriebsmannschaft, der (nach außen fokussierten) ProjektmanagerInnen, oder auch Erfahrungswerte der Produktentwicklung zurückgegriffen werden.
Nicht alle Content-Schaffenden sind allerdings derartig tief in die Kultur des Unternehmens eingebettet. Auch aus dieser Position heraus gibt es Methoden, qualitative Erkenntnisse über die Zielgruppen zu sammeln. Die Beobachtung von direkten Feedbacks (etwa Kommentare) auf Social Media sowohl in der eigenen Kommunikation, aber auch bei der Konkurrenz kann ein wertvoller Rechercheeinstieg in die Bedürfniswelt der Zielgruppe sein. Ebenfalls gibt es kaum eine Nische, für die keine öffentlichen Foren, Facebook- oder LinkedIn-Gruppen existieren, in denen die Lebenswelt der Zielgruppe beobachtbar und analysierbar wird – Welche Fragestellungen tauchen gehäuft auf? Wie antwortet die Community? Auf welche Hilfsmittel und Tools wird verwiesen? Welche „off-topic“ Diskussionen geben ganzheitlichen Einblick in die Lebenswelten? – Wie ein Naturforscher das Wasserloch aufsucht, bieten sich auch im User Research gerade jene Plattformen an, wo die Zielgruppe unter sich agiert und dennoch beobachtbar ist.

Metriken und Messbarkeit spielen ebenfalls eine zentrale Rolle: Wesentlich ist hier aber nicht die reine Fokussierung auf Erfolgs- und Effizienzmessung (z.B. Page Views), sondern die Bildung von qualitativen Hypothesen mit der Unterstützung durch quantitative Messdaten. Das Ziel ist stets, die Zielgruppe ganzheitlicher kennenzulernen. Deshalb bieten sich einerseits Verbünde von Metriken an, die durchaus auch antagonistisch agieren können: Wird etwa bei einer Kohorte die Conversion gemessen, so ist auch die Retention innerhalb der Kohorte interessant – Spreche ich die richtige Zielgruppe mit Botschaften an, die sich im Produkt reflektieren, oder enttäusche ich sie? Messe ich Verweildauern, ist auch die Traffic-Quelle interessant, um zu verstehen, mit welcher Intention NutzerInnen mit meinen Inhalten interagieren (explorative Google-Suche, fokussierte Recherche, usw…) und inwieweit meine Inhalte in diesen Kontexten hilfreich sind. Über den Upcycling-Prozess lassen sich solche qualitative Hypothesen auch implizit testen.
Auch für SEO ist Upcycling eine zukunftsträchtige Methodologie. Seit Mitte 2019 im englischsprachigen Raum getestet und im Dezember 2019 für zahlreiche Sprachen ausgerollt, darunter auch Deutsch, führt Google mit BERT eine neue Dimension in die Content-Analyse ein: Mittels eines Machine Learning Verfahrens werden die tatsächlichen NutzerInnenintentionen aus explorativen Suchanfragen estimiert und gerade jene Inhalte priorisiert, die tatsächliche Fragen aus der Realwelt beantworten. Während typische lokale SEO Ansätze wie Keyword-Analysen mittelfristig dadurch nicht obsolet werden, so werden sich doch einige Rankings sukzessive zugunsten jener Inhalte verschieben, die besser und konkreter auf Bedürfnisse eingehen – Eine Herangehensweise, die sich mit dem Gedanken des Upcyclings deckt.
Die Methode des Upcycling kann also eine wertvolle Perspektive in der Pflege und der Schaffung von Inhalten darstellen. Wie bei allen Methodologien werden in der Praxis insbesondere Mischformen am häufigsten eingesetzt. Dennoch ist der immanente Fokus auf die RezipientIn durchaus eine Maxime, die in der Entscheidungsfindung zwar nicht immer priorisiert sein muss, aber zumindest nicht vergessen werden sollte.